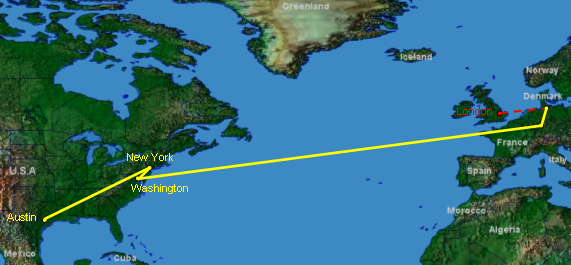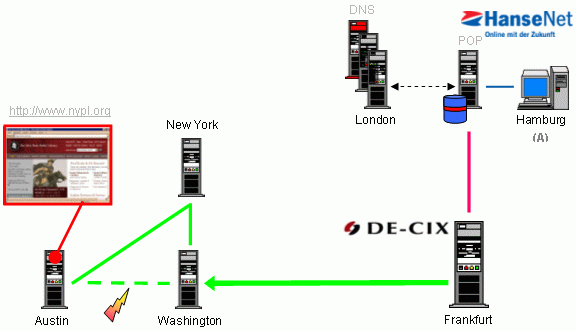Funktionsweise des World Wide Web
... [Seminar "Verteilte Systeme"]
... [Inhaltsverzeichnis]
... [weiter] ...
Abschlussbetrachtung
Als Zusammenfassung der vorhergehenden Kapitel soll an dieser Stelle ein
kompletter Seitenabruf einschließlich aller dazu benötigten Techniken erläutert
werden. Dazu möchte ein hamburger Hansenet-Kunde von seinem Rechner aus die
Webseite der öffentlichen Bibliothek in New York http://www.nypl.org/ (New York
Public Library) abrufen. Der in der folgenden Abbildung zu sehende Datenfluss
wurde mit VisualRoute (www.visualroute.com), einer grafischen Umsetzung des
Kommandozeilen-Tools traceroute, mitgeschnitten.
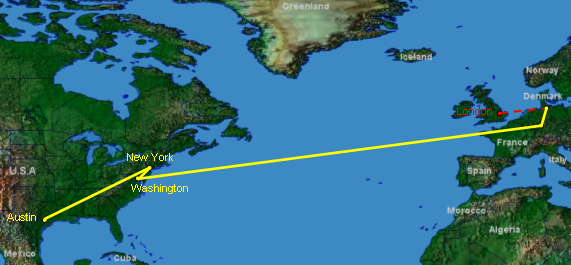
Um die Seite www.nypl.org abzurufen, verbindet sich der Hansenet-Kunde mit dem
POP seines ISP und bekommt von diesem eine IP zugewiesen. Anschließend gibt der
Kunde an seinem Rechner (A) die URL http://www.nypl.org/ in seinen Browser ein,
wodurch er eine DNS-Vorwärtsabfrage an den DNS-Server von Hansenet startet.
Angenommen die IP der gesuchten Bibliotheksseite ist nicht in dessen Cache
vorhanden, so wird die DNS-Abfrage an einen Root-Server, z.B. den Ripe-Server in
London, weitergegeben. Hierarchisch absteigend wird von hier aus die IP der
gesuchten URL ermittelt und das Ergebnis letztendlich über den DNS-Server des
ISP an den Hansenet-Kunden weitergegeben. Ausgerüstet mit der gerade erhaltenen
IP kann Rechner (A) seine Seitenanfrage über das Netz von Hansenet und das
Backbone-Netz zum DE-CIX in Frankfurt schicken.
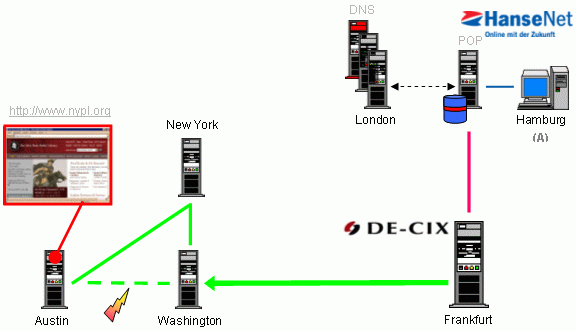
Von dort wandert sie über ein Unterseekabel rüber nach Washington, wo eine
starke Netzauslastung eine direkte Weitervermittlung nach Austin verhindert. Mit
Hilfe der Routingprotokolle EGP und BGP wird die Anfrage daraufhin über New York
nach Austin auf den Server mit der Seite der NYPL umgeleitet. Über das
Übertragungsprotokoll http und mit dem Anforderungsbefehl GET wird die
Startseite index.html von http://www.nypl.org/ auf den Rechner (A) übertragen
und in dessen Browser angezeigt.
Das World Wide Web wird ohne Frage in den nächsten Jahren weiter wachsen und
neue Nutzungsmöglichkeiten und Dienste hervorbringen. Dabei ist anzunehmen, dass
die bestehenden Konzentrationspunkte wie die vier großen Internetknoten in New
York, Washington, London und Paris sowie das DE-CIX vorerst weiter bestehen
werden. Dies ist momentan auf den harten Wettbewerb zwischen den großen Carriern
zurückzuführen, der auf Kosten der Sicherheit und Redundanz geht.
Auch die geografische Konzentration der 13 Rootserver wird sich wohl nicht so
schnell ändern, da ein Großteil der Rootserver historisch bedingt in den USA
steht. Jedoch bilden sich hier bereits die ersten Alternativen heraus. So gibt
es seit Ende 2002 ein "Open Root Server Network", welches parallel zu den
offiziellen 13 Rootservern zur Namensauflösung verwendet werden kann.
Bei der Vergabe von IP-Adressen sind ebenfalls Neuerungen zu erwarten, hier wird
in den nächsten Jahren die derzeitige IP Version 4 durch die neue Version 6
abgelöst werden, da der Adressraum von IPv4 langsam knapp wird.
Auch bei den Top Level Domains bahnen sich die ersten Engpässe an, weshalb in
den letzten Jahren immer wieder neue wie biz, .info oder .museum von der ICANN
genehmigt wurden.
Netzintern sind ebenfalls Änderungen zu bemerken, so wird weiterhin versucht,
den "Dark Adress Space" zu minimieren und zusätzlich Dokumente über URNs und den
neuen Dienst URS dauerhaft zu adressieren und auffindbar zu machen.
... [Seminar "Verteilte Systeme"]
... [Inhaltsverzeichnis]
... [weiter] ...